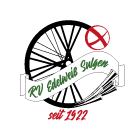Radlermusik

Probezeiten
Musiker ab ca. 16 Jahren
Aktuell keine festen Probezeiten, bei Interesse bitte den Ansprechpartner kontaktieren.
Versuch dich einfach mal!
Unkompliziert und ohne Anmeldung.
RV „Edelweiß“ Sulgen
Probelokal
Hardtstraße 16/1
78713 Schramberg

Geschichte der Radlermusik
Schon 1925 hatten einige Mitglieder des Radfahrervereins „Edelweiß“ die Idee, man könnte die damals wie heute zwar farbenfrohen, aber leider relativ stillen Korsoveranstaltungen durch musikalische Klänge etwas auflockern. Es dauerte nicht lange, bis sich eine kleine Gruppe zusammenfand, die begann, die ersten Musikstücke einzustudieren. Daß als Instrument die Schalmei ausgewählt wurde, war fast zwangsläufig, einerseits erfreute sie sich in den zwanziger Jahren einer recht großen Popularität, andererseits war sie Signalinstrument in Radfahrerkreisen bestens bekannt.
1926 trat die kleine Gruppe erstmals in die Öffentlichkeit. Schon von Anfang an hatten die Radlermusiker zum Ziel gesetzt, ihre Instrumente nicht nur im Stand, sondern auch auf Fahrrädern erklingen zu lassen. Diese Besonderheit brachte ihnen bereits im Gründungsjahr einen grandiosen Erfolg, denn die Korsomannschaft des RV „Edelweiß“ erreichte beim Bundeskorso des Landesverbandes dank der Zusatzpunkte für Originalität und Musik sensationell den ersten Platz, was in anderen Sportarten einem Meistertitel gleichzusetzen wäre.
Da der Radfahrer-Verein „Edelweiß“ ein unpolitischer Verein war, konte die Radlermusik noch bis 1941 auftreten. Andere Schalmeienkapellen gab es zu jener Zeit längst nicht mehr. Da aber die meisten Vereinsmitglieder im Krieg waren, verstummte zwangsläufig auch die Radlermusik.
Josef Laufer schaffte es, die Instrumente über die Kriegswirren hinwegzuretten, jedoch war der Neuanfang nach dem Kriege nicht sofort möglich, da ein anderer Sulgener Radfahrerverin plötzlich Besitzansprüche an den „Edelweiß“-Schalmeien anmeldete. Aber bereits Ende der 40er Jahre nahm die Radlermusik unter der Leitung von Hans Kieninger und August haas die Proben wieder auf.
In den 50er und 60er Jahren war es vor allem ein Verdienst von Paul Keck, daß die Radlermusik wieder zu neuer Blüte erstsrahlte. Besondere Förderung erfuhr sie ab 1979 durch Alfons Laufer. Ihm war es zu verdanken, daß die Musikanten auf nationalen und internationalen Schauplätzen auftreten konnten. Unvergessen sind die „Festivals der Pedale“ in München, Frankfurt, Essen, Darmstadt, Speyer, Sindelfingen, Hamburg und Lünen, sowie die Besuche in den Partnerstädten Hirson und Charleroi. Auch Fernseh- und Rundfunkauftritte durften die Radlermusiker erleben.
Mit Anton Herrmann erhielt die Radlermusik ihren ersten hauptamtlichen Dirigenten, der zusammen mit Notenschreiber Willi Spelge den Stil der Radlermusik bis zum heutigen Tag geprägt hat. Nach dem Tode von Anton Herrmann übernahm 1986 Manfred Gutgsell den Taktstock. Höhepunkt seines Schaffens war zweifellos die Aufnahme der Musikkassette „Schalmeiengrüße vom Schwarzwald“ im Jahre 1989.
Mit Cornelia Wernz, Esther Haas und Antje Irion traten 1989 drei junge Damen der Radlermusik bei, was in die bis dahin reine „Männerwirtschaft“ beachtlich frischen Wind brachte.
Siegmund Oehler als Dirigent zeigte sich ab 1996 für den Sound der Radlermusik verantwortlich. Mit neuen Rhythmen und Überarbeitungen traditioneller Stücke konnte er das Repertoire der Radlermusik beachtlich erweitern.
Ansprechpartner Radlermusik
Tobias Pfundstein
2. Vorsitzender
Tel. 0175 2413521
E-Mail: vizepraesident@rve1922.de